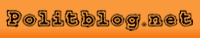Hintergrund: Ist Hochfeld überall?
Vom Leben in einer ethnischen Kolonie – Neue Studie zeigt positive und negative Potenziale von Migrantenvierteln auf – Von Yasin Alder, Bonn
(iz) Duisburg-Hochfeld ist ein Stadtteil, der bei einer flüchtigen Durchquerung eigentlich keinen besonderen Eindruck hinterlässt. Ein zentrumsnahes Viertel mit relativ hohem Migrantenanteil, von denen es in fast jeder größeren deutschen Stadt eines oder mehrere gibt. Der Sozialwissenschaftler Dr. Rauf Ceylan hat Duisburg-Hochfeld nun als exemplarisches Beispiel für seine Dissertation „Ethnische Kolonien – Entstehung, Funktion und Wandel am Beispiel türkischer Moscheen und Cafés“ gewählt und damit, für ihn selbst überraschend, ein erhebliches Medieninteresse geerntet. Bei Printmedien, Rundfunk, Fernsehen und Politik ist der junge Wissenschaftler, der selbst einen Migrationshintergrund hat und in Duisburg aufgewachsen ist, derzeit sehr gefragt. Offenbar kommt eine Arbeit zu diesem Thema angesichts der aktuellen Integrationsdebatte genau zum richtigen Zeitpunkt.
„Wir haben hier bei einer Einwohnerzahl von rund 16.000 einen Migrantenanteil von etwa 40 Prozent, davon stammen etwa die Hälfte aus der Türkei, also etwa 3.000 Türken. Dabei sind Einwohner mit Migrationshintergrund, also solche, die mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht mit erfasst“, erklärt Ceylan. Die Studie beschäftigt sich mit dem Wandel von Moscheen und Cafés im Laufe der letzten Jahrzehnte seit ihrer Gründung. Moscheen stellen ebenso wie die ethnischen Cafés wichtige soziale Orte, Zentren der Kommunikation und des Austausches dar. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor für die Wahl von Cafés als Untersuchungsobjekt sei aber auch gewesen, dass sich in den traditionellen, von türkischen Migranten aufgesuchten Cafés in letzter Zeit vermehrt Glücksspiel und Prostitution ausgebreitet hätten, berichtet Ceylan.
Er hat in Duisburg-Hochfeld fünf Moscheevereine sowie sieben von insgesamt zwischen 30 und 40 Cafès untersucht – einer vergleichsweise sehr hohen Zahl. Bei beiden Einrichtungen fand seit den späten 70er Jahren eine Ausdifferenzierung und Polarisierung statt – bei den Moscheen in verschiedene neu entstehende Verbände, bei den Cafés angesichts der damals starken Politisierung der türkischen Migranten vor allem in „linke“ und „rechte“ Cafés. Etwa ab 1983 habe, auch infolge des Rückkehrförderungsgesetzes, dann eine Phase der Normalisierung stattgefunden, so Ceylan. „Damals mussten viele Migranten, die von diesem Gesetz Gebrauch machten, feststellen, dass sie in der Türkei längst entfremdet sind und machten dort negative Erfahrungen, über die in der türkischen Presse auch ausführlich berichtet wurde. Das führte den Migranten vor Augen, dass eine Rückkehr unrealistisch ist und dass ihre Zukunft in Deutschland liegen würde.“
Parallel dazu habe allerdings in Deutschland eine Abwärtsentwicklung in den Stadtteilen stattgefunden, gekennzeichnet durch De-Industrialisierung, zunehmende Arbeitslosigkeit und Zuzug weiterer sozial schwacher Gruppen, sodass auch ein Stadtteil wie Hochfeld sein Gesicht gewandelt habe. Die Moscheen wurden, so Ceylan, im Laufe der Zeit von rein „sakralen“, also vor allem dem Gebet vorbehaltenen Orten, zu multifunktionalen Zentren, die versuchen, die Probleme ihrer Mitglieder verstärkt abzufangen. Die Cafés haben sich im Zuge einer Entpolitisierung der türkischen Migranten weiter ausdifferenziert – nach Herkunftsregionen, Altersstruktur und Angeboten. Die eher traditionell geführten Cafés distanzierten sich dabei von den Cafés, in die in den letzten Jahren Drogen, Glücksspiel oder Prostitution Einzug gehalten haben. „Es gibt eine Dynamik bei diesen Einrichtungen. Das Café in Anatolien kann eine ganz andere Funktion übernehmen als das Café hier in Deutschland. Genauso auch die Moscheen“, sagt Ceylan.
Keine „Ghettos“
Rauf Ceylan zieht es vor, bei Stadtteilen wie Hochfeld von ethnischen Kolonien zu sprechen statt von „Ghettos“, da Ghettos, wie etwa in Amerika, großflächigere Areale seien, die nur von einer ethnischen Gruppe bewohnt werden und keine Außenkontakte, keine Offenheit zur Mehrheitsgesellschaft haben. Eine großflächige Segregation gebe es aber in Deutschland nicht, die Infrastruktur werde auch von Bewohnern anderer Stadtteile in Anspruch genommen, und drittens stellten Migranten in solchen ethnischen Kolonien deutscher Städte in der Regel höchstens ein Drittel der Bewohner dar und seien zudem nochmals in verschiedene Ethnien differenziert.
Hauptergebnisse der Studie sind laut ihrem Autor, dass ethnische Kolonien wie Hochfeld entgegen verbreiteter Vorurteile dynamisch sind und nicht in sich geschlossen, und dass sie sich in einer Übergangsphase befinden, die positive Potenziale beinhaltet, in der die bestehende Problemakkumulation im negativen Fall aber auch dazu führen könne, dass die Kolonie stagniert. „Die Moscheen sind nicht in der Lage, diese Probleme abzufangen, denn sie haben begrenzte Ressourcen. Es gibt Kräfte, die diese Probleme erkennen und sich öffnen wollen, die aber mit diesem Öffnungsprozess nicht so erfolgreich sind. Die Öffnung wird ihnen auch teilweise von Außen verwehrt, etwa aufgrund ihrer Verbandszugehörigkeit. Es gibt junge Aktive, die sich im Stadtteil engagieren wollten, denen man aber gesagt hat: ‘Herr G., mit Ihnen persönlich haben wir keine Probleme, aber Ihre Moschee gehört der Milli Görüs an.’ Es ist wichtig, dass man diese Öffnungsprozesse unterstützt und nicht abweist, weil dies dazu führt, dass diese Leute sich zurückziehen.“
Der 33-Jährige Imam Yusuf Ucar von der Moschee in der Friedensstraße ist gleichzeitig ausgebildeter Sozialarbeiter. Er sagt: „Das wichtigste ist, dass wir unseren Leuten hier helfen, sich zu integrieren, und in dieser Gesellschaft, die auch unsere Gesellschaft geworden ist, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir unsere Identität, Religion und Kultur pflegen, sie den anderen Menschen mitteilen und friedlich mit ihnen leben können.“
Wir treffen den Imam bei der Arbeit auf der Baustelle im Moscheegebäude an. Eigenarbeit ist bei Moscheebauten und -umbauten üblich, und dass auch der Imam dabei Hand anlegt, verwundert nicht unbedingt. Ungewöhnlicher erscheint, dass hier derzeit auch zwei nichtmuslimische Hartz IV-Empfänger als Helfer tätig sind. Deutsche Arbeitslose helfen beim Moscheebau, als Tätigkeit für das Gemeinwohl im Rahmen einer ARGE-Maßnahme. Die Moschee hat umfangreiche Aktivitäten für Männer und Frauen verschiedener Altersgruppen, die teilweise auch von nichtmuslimischen Nachbarn genutzt werden. Zu den Angeboten gehören auch Ausflüge und Stadtführungen für Jugendliche, die oft ihre eigene Heimatstadt kaum kennen. „Unsere Arbeit wird allgemein sehr positiv aufgenommen, auch von den Medien. Aber die deutschen Sprachkenntnisse sind ein Problem. Die meisten Imame hier in Duisburg sprechen kaum oder gar kein Deutsch. Bei Übersetzungen geht viel verloren, und von Herzen sprechen kann man nur, wenn man eine Sprache auch gut beherrscht“, sagt der Imam und Sozialarbeiter.
Die Bildungschancen von Kindern, so Ceylan, hingen eng damit zusammen, in welcher Art von Stadtteilen sie leben. „Deswegen wäre eine öffentliche Bücherei hier von elementarer Bedeutung, denn die Armutsfamilien haben ja kaum Bücher zu Hause.“ Die einzige Stadtbibliothek in Hochfeld wurde jedoch vor einigen Jahren geschlossen. Darin befindet sich nun eine Videothek, die ihr Angebot an „Erotik“-DVDs auch in türkischer Sprache anpreist. Rauf Ceylan hält dies für sehr symbolträchtig. In Duisburg-Hochfeld wird auch die Filiale einer bekannten deutschen Bäckerei-Kette zu einem türkischen Café – alle Tische sind in der Mittagszeit voll besetzt mit türkischen Männern. An einer anderen Ecke wiederum wird eine, früher wohl als „typisch deutsch“ betrachtete Imbissbude mit Grillhähnchen und Pommes von einem Türken geführt, der, wie sich herausstellt, in der Türkei eine akademische Ausbildung absolviert hat. Mustafa Calik ist sozial engagiert und unterstützt eine obdachlose Frau, die keine Familie hat. „Ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln dafür zu sorgen, dass sie nicht verhungert.“ Er ist ein guter Beobachter des sozialen Geschehens in Hochfeld, der auch schon Jugendliche bei einem versuchten Einbruch in seine Imbissbude ertappen musste, denen er zuvor umsonst Pommes gegeben hatte. Immer mehr Arbeitslose und Obdachlose, so Calik, rutschten in die Kleinkriminalität und Kriminalität ab, ein eindeutiger, beunruhigender Trend. Warum er einen klassisch deutschen Imbiss und keinen Dönerladen betreibe, erklärt er ganz nüchtern: „Weil hier eine Nachfrage nach so etwas bestand. Döner-Imbisse gibt es schon genug, und außerdem machen die sich mit einem harten Preiskampf gegenseitig kaputt.“
Die Grillhähnchen sind bei Herrn Calik natürlich halal geschlachtet, und Alkohol ist nicht im Angebot. Man müsste Hochfeld aufwerten, meint er, zum Beispiel, indem selbstständige Unternehmer im Sinne sozialer Solidarität gemeinsam über Lösungen für Obdachlose und soziale Härtefälle nachdenken. Auch seiner Ansicht nach mache der besuchte Schultyp für den späteren Erfolg oder Misserfolg der Jugendlichen und für ihre persönliche Entwicklung enorm viel aus, wie er aus der Erfahrung seiner Familie weiß: „Die Bildung macht den Unterschied – die Hauptschule ist nichts mehr wert.“
Potenziale fördern
Die Grillhähnchen gibt er uns heute aus: „Man muss auch geben können.“, sagt er auf Nachfrage dazu. Bei vielen anderen Geschäftsleuten wäre so etwas wohl kaum denkbar. Es ist diese soziale Kompetenz, die gegenseitige Hilfe, die Kommunikation auf menschlicher Ebene, der kleine Plausch mit dem Ladenbesitzer, der diese ethnische Kolonie lebenswert macht, gerade da dies in der deutschen Gesellschaft, in der Kälte und Anonymität immer mehr um sich greifen, zunehmend fehlt. Laut Rauf Ceylan gibt es daher auch Deutsche, die ganz bewusst in Hochfeld leben, weil sie dies zu schätzen wissen. „Diese informellen Beziehungen machen Hochfeld aus“, meint auch er. „Beziehungen zu anderen Selbstständigen, dass der Besitzer auch mal etwas ausgibt oder Bedürftige unterstützt. Das ist hier weit verbreitet. Das sind Aspekte des Stadtteillebens, die nicht transparent genug sind und in der Öffentlichkeit gar nicht thematisiert werden. Dies müsste noch mehr gefördert werden. Das kulturelle und soziale Kapital ist hier immer noch vorhanden, davon könnte auch die Mehrheitsgesellschaft profitieren.“ Ceylan sieht eine große Diskrepanz zwischen der meist negativen öffentlichen Wahrnehmung solcher Stadtteile und der Realität.
Er plädiert dafür, die positiven Potenziale ethnischer Kolonien anzuerkennen und zu fördern, statt sie durch Ausgrenzung und Stigmatisierung zu blockieren, was eher zu einer negativen Entwicklung, zu Regression und Selbstausgrenzung führen würde.
http://www.islamische-zeitung.de/